|
2024/04/27
Autor: Christoph Buggert
Kopfstein Lesen Sie allererste Kritiken!So begeisterten sich Kritiker beim Debüt des Autors
|
KopfsteinDie Abschafffung des Unglücks. Dritter Teil
Christoph Buggert justiert präzise wie ein Uhrmacher, wie die scheinbar geordneten Lebensverhältnisse eines Literaturprofessors über 45 Jahre, teils mit erschreckenden Ereignissen und immer mit Wucht, ineinander griffen und dies Laufwerk unzurückdrehbar in dauernde Unruhe brachten. Hörigkeit, Morde, Fälschungen wurden zu deren unsichtbarer Feinmechanik.
Clara liebt Walter. Grit liebt Walter. Jochen liebt Walter. Clara heiratet Jochen. Walter heiratet Grit. Clara heiratet Jochen.
Alles wäre nun gut. Wäre nicht so Vieles verschwiegen worden...
Die Paare sind längst keine Paare mehr. Die Freunde gingen auseinander. Die Lebenswege haben sich getrennt - und kreuzen sich dennoch ständig, mal mehr, mal weniger, mal unscheinbar, mal mit radikalen Konsequenzen. Wie kam Jochen in den Knast? Beruhte Walters Professur auf Scharlatanerie?
Hätte! Es war aber nicht so. Oder doch? Würden die Dramen, die sich oft früh abzeichneten, dann weniger grausam? Wäre es anders gekommen, wenn man die Zeit zurückdrehen oder bloß an der Uhr nach- oder vorstellen könnte?
Wie bloß kann man das Unglück abschaffen? All das, was sich im Leben mit der Zeit und dem Zögern anhäufte und die Bewegungsfreiheit noch mehr als das Zaudern einschränkte. All die falschen oder die versäumten Entscheidungen! Das, was gewollt war und gelassen wurde!
Da fügt sich am Ende vielleicht Vieles zusammen, was nicht zusammengehörte. Christoph Buggerst stellt seinem Roman Kopfstein ein Zitat von Anton Tschechow voran: „Unsere Erinnerung reiht nicht Stunde um Stunde hintereinander, wie die Uhren es machen. Sie wählt hier eine Stunde aus, fügt von dort die nächste an, springt vor und zurück. Der wäre dem Leben auf der Spur, der so eine Maschine konstruieren könnte.“
Die jeweils erinnerte Geschichte konzentriert sich dabei auf lediglich neun, gleichwohl lebenswichtige Monate.
Da wird beispielsweise die Jugendreife in Bremen nachgezeichnet wird: Walter und sein Schulfreund Jochen fühlen sich so erlesen, dass sie gemeinsam einen Mord an einem Drogisten begehen wollen. Später heiratet ausgerechnet Walter heimlich Clara, Jochens innige Geliebte. Er wird ein Kunstfälscher aus Überzeugung, Walter ein angesehener Literaturwissenschaftler. Doch immer wieder holen sie ihre frühen Lügen und Halbheiten ein. Gefängnis, Morde, Gierigkeit und Eifersucht führen zu immer mehr Irrungen bei der Abschaffung des Unglücks.
Neuveröffentlichung Kopfstein Sie können den Roman Kopfstein gleich hier bestellen.
Das Unglück einfach mal abschaffen?Was hindert wie ...
Wie bloß kann man also das Unglück abschaffen? All das, was das Leben so ausweglos scheinen lässt. Der "Held" in "Kopfstein" reist viel, oft auf der Flucht vor sich selbst, dann auf der Suche nach dem verschwundenen Freund. Am Ende ist nicht mal im Garten seines früheren Familienhauses ein Platz für ihn im Busch.
Wie kommt es zu all den falschen oder den versäumten Entscheidungen im Leben? Anton Tschechow, dem Christoph Buggert erzählend nachfolgt, schrieb in "Der Kirschgarten" über das Glück und die aufreibende Suche nach dem Sinn: „All das Kleinliche, Trügerische abstreifen, das uns hindert, glücklich zu sein – das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Nur vorwärts!“
Doch so einfach ist es wohl nicht. Tschechow beispielsweise haderte mit seinem Protagonisten "Iwanow", der in der ersten Fassung noch "Held" einer Komödie war, doch dann zum Selbstmörder in einer Tragödie wird.
An seinen Verleger A. S. Suvorin schrieb Tschechow, noch vor dieser literarischen Verwandlung am 30. Dezember 1888: "Iwanow aber, als gerader Mensch, erklärt dem Arzt und dem Publikum offen, dass er sich nicht verstehen kann. Die Veränderung, die in ihm vorgegangen ist, kränkt seinen Anstand. Er sucht die Ursachen außerhalb und findet sie nicht; er beginnt, sie in seinem Innern zu suchen und findet einzig und allein ein unbestimmtes Schuldgefühl. Darum quält ihn jeden Augenblick die Frage: wohin mit mir? Iwanow ist müde, er begreift sich nicht, aber das Leben kümmert sich darum nicht im mindesten. Es stellt seine gesetzmäßigen Forderungen an ihn, und er muss – ob er will oder nicht – diese Fragen lösen. Ermüdbarkeit äußert sich nicht allein in Gejammer oder dem Gefühl der Langeweile. (...) Alle müden Menschen verlieren nicht die Fähigkeit, sich in höchstem Maße zu erregen, aber nur für sehr kurz, wobei nach jeder Erregung eine noch größere Apathie einsetzt."
Solch ein "Held" ist auch der Literaturprofessor in Christoph Buggerts "Kopfstein". Nur begeht am Schluss dessen Schulfreund Selbstmord - und dessen Witwe versucht mit ihrem früheren Geliebten, die letzten Schlüsse aus vertanen Ideen und Träumen zu erkennen. Lief im Leben wirklich etwas "falsch"? Oder gerät im Rückblick alles zu sentimental, was in der Gegenwart sich sogar noch bizarrer darstellt?
Ist die Fälschung die ehrlichste Kunst?Die Literatur als Archäologie des Alltags? Buggerts zeitloser, sozial-psychologischer Roman "Kopfstein"
Christoph Buggerts Roman Kopfstein widersetzt sich der süffigen Lektüre, wie sie derzeit die schwachen Herzen der Rezensenten erfüllt. Der Text springt zwischen den Zeitläuften und den Ansichten derer, die sich das Miterleben schön reden oder erklären wollen. Es ist ein sozial-psychologischer Roman, wie er scheinbar "unmodern" geworden ist - und damit zugleich schockierend aktuell.
Auf die ungewohnte Form trifft am ehesten zu, was der Literatur-Nobelpreisträger (2019) Peter Handke in "Tage und Werke: Begleitschreiben zu Büchern und Autoren 2008-2014" über Luc Estangs Buch Die Stunde des Uhrmachers schrieb: "Durch den Wechsel der Ebenen wirkt zwar die Lektüre ein wenig verwirrend, jedoch gerade dadurch auch mehr zum Mittun fordernd, bei aller Klarheit vieldeutiger, in ihrer geheimnisvollen Magie anziehender und, das Wort sei erlaubt, undurchschaubarer und tiefer. (...) Oft wird heutzutage gesagt, der psychologische Roman sei unzeitgemäß, seine Zeit sei vorüber, jeder psychologische Analyse wisse es besser. Hier, in diesem psychologischen Roman, zeigt sich, wie lächerlich derartige Allgemeinurteil sind."
Verspielt macht sich Christoph Buggert über die Buch-Welt lustig, wie sie auf den Buchmessen oder in den Feuilletons aufscheint: Literaturwissenschaft beispielsweise, so lautete die keineswegs selbstkritische These seines ängstlichen "Helden", ist bis heute Archäologie geblieben. Allenfalls werde gefragt, in welchem geschichtlichen oder aktuellen Zusammenhang ein Text verfasst wurde. Und welche Form dazu dienlich gewesen sei. Doch was ist mit dem Warum? Was veranlasst das menschliche Hirn, künstliche Welten zu erschaffen? Wie kann es passieren, dass wir reinen Erfindungen mehr Wahrheitsgehalt zuerkennen als der Realität selbst? Warum ensteht aus toten Buchstaben etwas so Kompliziertes wie Poesie?
Und auch der tragische Widerpart der Hauptfigur hat eine provozierende Lebenserkenntnis: „Die Fälschung ist die ehrlichste Form der Kunst. Niemand stößt sich daran, wenn ein Maler oder Autor die Wirklichkeit bloß vortäuscht. Im Gegenteil, man sieht eine heilige Handlung darin. Also muss doppelte Meisterschaft dahinter stecken, wenn auch die Herstellung der Täuschung eine Täuschung ist.“
"Erste" Pressestimmen zum Romancier Buggert und dessen Debüt "Das Pfarrhaus" (1988)...
Mechthild Egen am 4. Mai 1988 im SDR 2
Werner Schulze-Reimpell am 5. November 1988 in der Stuttgarter Zeitung
|

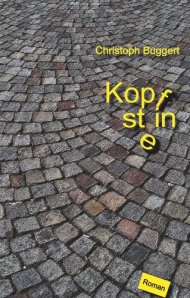
![Copyright: Rainer Jogschies (Nachttischbuch-Verlag, Berlin 2019)Roman-Rückseite DEUTSCHKRANK (ISBN-13: 9-78-3-937550-26-8), Hamburg 2019. Jegliche Vervielfältigung oder Weitergabe sowie Verwendung, auch private, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages und ist honorarpflichtig (einzuholen unter info[at-Zeichen]nachttischbuch.de).](content/images/6f4d27e936f0e30ae9647e0371ec8b0d.jpg)
